Zurück zur Blogübersicht
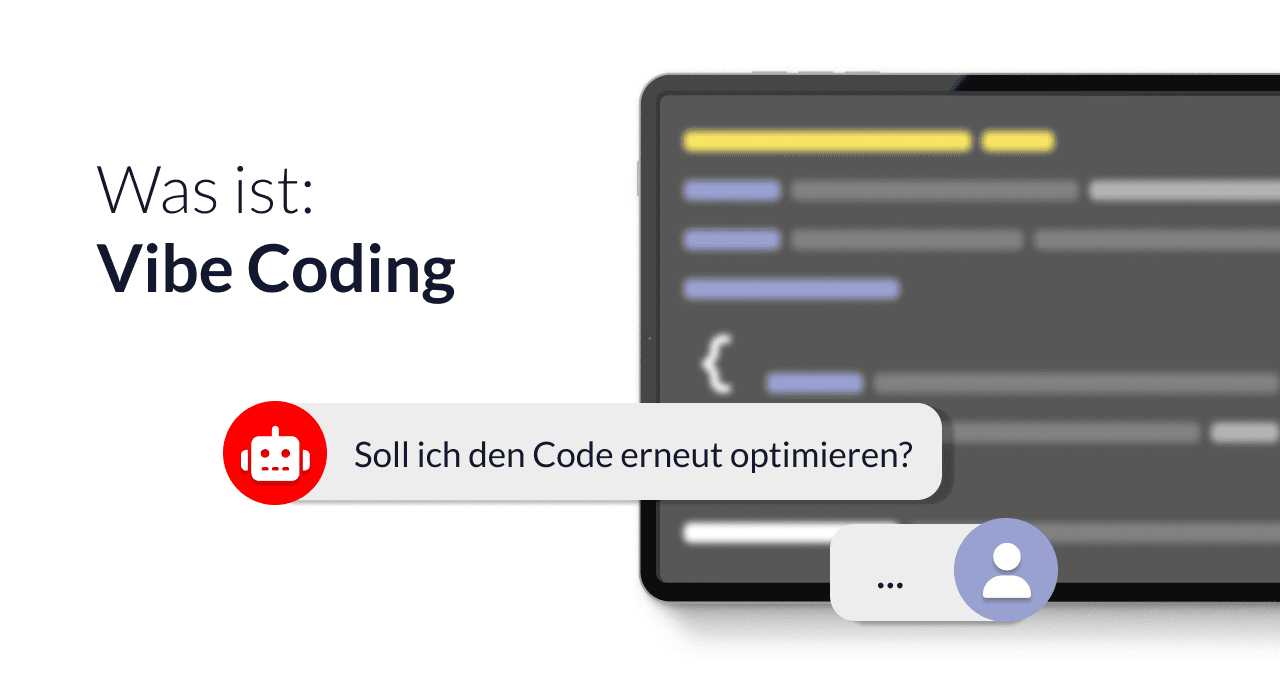
Vibe Coding: Programmieren neu gedacht?
Die Art und Weise, wie wir Software entwickeln, verändert sich rasant. Künstliche Intelligenz macht es möglich, dass Code nicht mehr nur über klassische Editoren Zeile für Zeile entsteht, sondern über Sprache, Gefühle und Interaktionen. Dieses Konzept ist unter dem Begriff Vibe Coding bekannt. Doch was steckt eigentlich dahinter?
Was ist Vibe Coding?
Vibe Coding beschreibt eine neue Form des Programmierens, bei der Entwickler in natürlicher Sprache, über Emotionen oder kreative Inputs mit einer KI interagieren, um Software zu erstellen. Statt Syntax auswendig zu lernen oder komplexe Strukturen selbst zu entwerfen, steht der „Vibe“ (also die Idee, Stimmung oder Intention) im Vordergrund.
Einfach gedacht bedeutet es: Du beschreibst, was du haben möchtest, und die KI übersetzt es in lauffähigen Code.
Vibe Coding Definition
Der Begriff an sich ist ziemlich neu. Zum ersten Mal eingeführt wurde der Begriff von Andrej Karpathy und das erst zu Beginn des Jahres 2025. Eine kurze Definition:
Vibe Coding ist ein KI-gestützter Ansatz zum Programmieren, bei dem natürliche Sprache, visuelle oder emotionale Eingaben genutzt werden, um Code automatisch generieren und anpassen zu lassen.
Vibe Coding Tools
Die Basis von Vibe Coding bilden KI-gestützte Entwicklungsumgebungen, welche in den meisten Fällen einfach heruntergeladen und direkt gestartet werden können. Sie übernimmt die Erstellung des Codes, die Anpassung und weitere themenbezogene Aufgaben. Typische Tools sind z.B.:
KI-Codex-Modelle wie GitHub Copilot, ChatGPT oder Replit AI
Visuelle Interfaces, die Code in Diagrammen oder Blöcken darstellen
Sprachassistenten, die Anforderungen direkt aus gesprochener Sprache verstehen
No-Code/Low-Code-Plattformen, die zunehmend mit KI-Unterstützung arbeiten
Ablauf: Wie funktioniert Vibe Coding?
Idealerweise agieren beim Vibe Coding Entwickler mit der KI und nutzen sie als Unterstützung, die aber kritisch geprüft wird. Der Ablauf bezieht sich dann auf die folgenden Schritte:
Idee formulieren: Du kannst z. B. in natürlicher Sprache folgendes mit der KI kommunizieren: „Erstelle mir eine To-Do-App mit Kategorien und Erinnerungsfunktion.“
KI generiert Code: Das System schreibt dir daraufhin automatisch die Grundstruktur
Feedback geben: Entwickler passen den „Vibe“ an, indem sie z.B. folgende Anforderungen stellen: „Mach es minimalistischer, mit dunklem Theme.“
Iterationen: Durch weitere Anweisungen wird der Code von der KI (im Austausch mit dem Entwickler) optimiert
Feinschliff: Manuelle Korrekturen sind möglich, aber nicht zwingend nötig
Anmerkung: Durch den offenen Zugang zu KI-Tools für fast jeden Internetnutzer wird das Vibe Coding auch vermehrt von Amateuren bzw. Nicht-Entwicklern genutzt, um die eigenen Projekte umzusetzen. Welche Vor- und Nachteile gerade dort ansetzen zeigen wir im nächsten Kapitel.
Vor- und Nachteile von Vibe Coding
Für Entwickler
Für erfahrene Programmierer bietet Vibe Coding einen enormen Geschwindigkeitsvorteil. Routineaufgaben wie das Schreiben von Boilerplate-Code, Standardfunktionen oder einfachen Datenstrukturen können in Sekunden erledigt werden. Das erlaubt es, mehr Zeit in Architektur, Logik und kreative Problemlösung zu investieren. Auch beim Prototyping zeigt Vibe Coding seine Stärke: Ideen können schnell in funktionierende Anwendungen übersetzt werden.
Allerdings bringt der Ansatz auch Schattenseiten mit sich. Entwickler riskieren, den Überblick über die generierte Codebasis zu verlieren, da nicht jeder Schritt manuell geschrieben wird. Sicherheitslücken oder ineffiziente Strukturen können unbemerkt bleiben, wenn man sich zu sehr auf die KI verlässt. Zudem kann das tiefe technische Verständnis leiden, wenn man sich langfristig stärker auf Vibe Coding verlässt als auf klassische Coding-Skills.
Für Nicht-Entwickler
Für Menschen ohne Programmierhintergrund ist Vibe Coding ein regelrechter Türöffner. Endlich wird es möglich, eigene App-Ideen, kleine Automatisierungen oder Prototypen ohne jahrelanges Studium der Syntax umzusetzen. Das senkt die Eintrittsbarriere zur Softwareentwicklung enorm und macht Technologien auch für Kreative, Unternehmer oder Hobby-Tüftler zugänglich.
Doch auch hier gibt es klare Grenzen: Wer keinerlei technisches Verständnis mitbringt, stößt schnell an Punkte, an denen die KI zwar Vorschläge liefert, aber nicht erklärt, warum etwas nicht funktioniert. Ohne ein Grundverständnis für Logik und Datenstrukturen kann es schwer werden, Fehler zu erkennen oder die Qualität des Codes einzuschätzen. Auch entsteht eine gewisse Abhängigkeit, denn ohne die KI-Tools bleibt man als Nicht-Entwickler schnell handlungsunfähig.
Vergleich: Vibe Coding vs. Traditionelles Coding
Kriterium | Vibe Coding | Traditionelles Coding |
Einstieg | Sehr niedrig, auch für Laien möglich | Höher, erfordert Fachwissen |
Geschwindigkeit | Sehr schnell | Abhängig von Erfahrung |
Kreativität | Hoher Fokus auf Ideen & Konzepte | Stark von den Skills des Devs abhängig |
Fehlerkontrolle | KI kann Fehler einbauen | Menschliche Logik prüft genauer |
Unabhängigkeit | Stark abhängig von Tools & KI | Vollständig eigenständig möglich |
Lernfaktor | Wenig technisches Lernen | Tiefes technisches Verständnis |
Sicherheit | Potenziell riskant (Black-Box) | Vollständig unter eigener Kontrolle |
Fazit
Vibe Coding ist kein Ersatz, sondern eine Erweiterung der Programmierwelt. Es macht den Einstieg einfacher, beschleunigt Entwicklungsprozesse und setzt kreative Energien frei. Gleichzeitig sollten Entwickler aber die Grenzen kennen: Nur wer die Grundlagen versteht, kann generierten Code wirklich bewerten und sicher einsetzen. Die Zukunft des Codings liegt vermutlich irgendwo dazwischen als eine Zusammenspielt aus menschlicher Logik und KI-Kreativität.
Das könnte Dich auch interessieren:
Was ist echt und was ist KI? Eine Frage die immer häufiger aufkommt. Erfahrt hier, wie ihr KI-Inhalte frühzeitig erkennt und welche Kompetenzen ihr schulen solltet, um dies mit Weiterentwicklung der KI aufrecht zu erhalten.
Vibe Coding verändert, wie Software entwickelt wird: statt Code Zeile für Zeile zu tippen werden Ideen beschrieben und KI macht daraus Anwendungen. Hier erfährst du, was Vibe Coding ist, welche Tools es gibt, wie es im Ablauf funktioniert und welche Chancen und Risiken es für Entwickler und Nicht-Entwickler mit sich bringt.
Bring dein Online-Business mit AI Commerce auf das nächste Level! Erfahre, wie KI im E-Commerce Empfehlungen personalisiert, Lager effizient verwaltet, den Kundenservice automatisiert und deine Umsätze steigert.
Cyberangriffe sind allgegenwärtig, besonders für Unternehmen. In diesem Beitrag zeigen wir dir, wie du dein Unternehmen mit den richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen besser schützt und worauf es wirklich ankommt. Von Grundlagen bis Praxistipps!
Mehr als nur schön aussehen: Warum eine moderne Website für KMUs heute entscheidender denn je ist – und was wirklich zählt. Wir zeigen dir, welche Funktionen, Inhalte und Strategien deinen Webauftritt wirklich erfolgreich machen.
Klingt spannend?
Wir sollten uns kennenlernen!